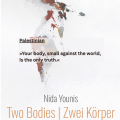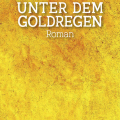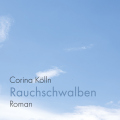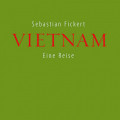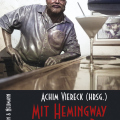Gesine Schmidt schreibt über Bärbel Lückes neues Buch Nach dem Krieg – Ein Kindheits-Kaleidoskop:
Bärbel Lückes Kindheits-Kaleidoskop ist ein außerordentlich mutiges, bewegendes und eindrucksvoll geschriebenes Buch über ihre Kindheitserfahrungen. Es beeindruckt durch seine Ehrlichkeit und Detailgenauigkeit, mit der das Leben in der Nachkriegszeit in einer Essener Zechensiedlung dargestellt wird. Dabei stehen nicht Armut und Enge der Wohnverhältnisse im Mittelpunkt – die Mutter, Witwe eines im Krieg verstorbenen Wehrmachtssoldaten, durfte mit ihren zwei Töchtern immerhin in der Zechensiedlung zu den alten Konditionen mietfrei wohnen bleiben -, sondern die unheilvolle Familiensituation. Im Mittelpunkt steht dabei die Mutter, die ihre Kinder, vor allem aber die jüngere Tochter, ohne jede Liebe und Zuneigung zu erziehen versucht.
Diese Mutter wirkt wie eine Protagonistin des Erziehungsmodells von Johanna Haarer, Autorin des 1934 veröffentlichten Buches Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses in der NS-Zeit sehr populäre Buch wurde 1945 zunächst von den Alliierten verboten, unter dem korrigierten Titel Die Mutter und ihr erstes Kind – ohne Hinweis auf die Erstausgabe – später erneut etwas korrigiert herausgegeben, 1987 (!) in letzter Auflage.
Die Maxime dieses Erziehungsmodell ist, kurzgefasst, dass man einen Säugling nur mit Nahrung und Körperpflege versorgen muss, aber nicht verzärteln dürfe, weshalb man ihn z.B. schreien zu lassen hat, wenn er Hunger hat, weil die vier Stunden „Wartezeit“ bei der Ernährung eingehalten werden muss. Wenn das Geschrei zu stark würde, sollte man das Kind einfach in ein abgelegenes Zimmer abschieben. Dies beherzigte die Mutter der Autorin so intensiv, dass sie das Kind bei Gelegenheit in ein ganz weit entlegenes Zimmer schob, wo man es auch im Notfall nie hätte hören können. Bei Johanna Haarer steht dieses Erziehungsmodell ganz klar in dem Kontext, für den nationalsozialistischen Staat Kinder zu erziehen, die, Härte gewohnt, diszipliniert und gehorsam einer Autorität zu folgen bereit sind. Auch nach 1945 folgten offenbar noch viele Mütter dieser Devise.
Bei der Mutter der Autorin kam obendrein noch die Haltung vieler sog. Kriegerwitwen hinzu, dass man die Strenge des im Krieg verstorbenen Mannes und Vaters jetzt als Frau und Mutter ersetzen müsse, um das Kind zu disziplinieren und nicht zu verweichlichen. Eine solche Erziehung haben auch in meinem Lebensumkreis etliche Kinder von sog. „Kriegerwitwen“ erfahren. Sie bedeutete für das Kind: keine Zärtlichkeit und keine tröstende Körpernähe zu erfahren, stattdessen harte körperliche Züchtigung bei den kleinsten Vergehen.
Die Erinnerung daran und die Auseinandersetzung mit den Erziehungsmethoden der Mutter waren für die Autorin schmerzhaft. „Diese Kindheit hat mein Leben bestimmt, weil ich mich ewig unglücklich gefühlt habe, unzulänglich, schuldig in allem, was ich tat…“ (S.161). Wie schon im Titel ihres Buches genannt, wählt sie als literarisches Verfahren ein „Kaleidoskop“ dieser verschiedenen Erinnerungen. „Ich erinnere mich nur noch an stumpfe Splitter unzusammenhängender Ereignisse. Manche formen sich zu skizzenhaften Bildern, die aus einem Kontinuum von Erlebnissen herausgestanzt erscheinen wie bei einer ungeschickten Laubsägearbeit.“ (S.161) Bärbel Lücke wählt keine chronologische Darstellungsweise, sondern fügt kaleidoskopartig die wichtigsten Momentaufnahmen ihrer Kindheitserfahrungen und deren Reflexion zusammen. Diese Momentaufnahmen sind jedoch sehr konkret, bildhaft und präzise. Sie ergeben das erschreckende Porträt einer „toxischen Mutter“.
Diese Mutter konfrontiert ihre noch halbwüchsige Tochter mit der Aussage, dass sie im Krieg überhaupt kein zweites Kind haben wollte, dass sie sie deshalb auch lieber tot geboren hätte und dann beim Bombenalarm „vergaß“, ihre neugeborene Tochter mit in den Luftschutzkeller zu nehmen. Was das für das Selbstwertgefühl der Tochter bedeutet hat, war ihr offenbar nicht nur egal, vielmehr zielte es darauf ab, dass sich das Kind schon in seiner Existenz schuldig fühlen musste.
Die Lieblosigkeit dieser Mutter zeigte sich im Alltag auch darin, dass sie keinerlei Körpernähe zuließ. So weckte sie ihre noch kleinen Kinder morgens mit lauten Aufstehbefehlen aus der Küche und dachte gar nicht daran, auch nur ans Kinderbett zu treten. Zur psychischen Gewalt trat wegen der kleinsten kindlichen Verfehlung die körperliche Züchtigung, mit einem Holzlöffel oder einem Kohlenstössel. Eine Prügelstrafe hat sich dem Kind besonders ins Gedächtnis gebrannt. Noch nicht Schulkind, geht sie mit anderen, älteren Kindern in eine nahe gelegene Schrebergartensiedlung, um Beeren – nur vom Wegrand aus – zu naschen. Das wird entdeckt und ein Gartenbesitzer erwischt das kleinste Kind und nimmt es mit zur Mutter. Die verprügelt ihr Kind vor dem eigenen Haus in aller Öffentlichkeit mit einem Holzlöffel auf dem nackten Hinterteil mit den Worten: „So, alle können sehen, dass ich auch ohne Mann meine Kinder erziehen kann.“ (S.96).
„Warum haben sich gerade diese Prügel, von den vielen, die ich in meiner Kindheit bekam, so unauslöschlich in mein Gedächtnis eingeprägt? (…) Es waren auch nicht die Schmerzen, die mir so zugesetzt hatten. Es war die Scham, öffentlich gezüchtigt, und dafür auch noch entblößt zu werden. Später kam auch noch das Gefühl der Ungerechtigkeit dazu…“. (S.96-97).
Bärbel Lückes Text versucht zugleich zu ergründen, warum ihre Mutter „so hart, so gefühlsmäßig verpanzert und gewalttätig“ (S.151) gewesen ist. Sie findet in späteren Gesprächen mit ihrer Mutter bei dieser aber wenig Bereitschaft, darüber Auskunft zu geben. In Bruchstücken erfährt die Autorin, dass auch der Vater ihrer Mutter gewalttätig gegenüber seinen Kindern und seiner Ehefrau gewesen ist. Diese beschädigte Kindheit hat die Mutter jedoch weitestgehend verdrängt und nie versucht zu verarbeiten. Anknüpfend an Merleau-Ponty analysiert Lücke, dass ihre Mutter durch nicht bewältigte Traumata in einer Art Fixierung der Vergangenheit steckengeblieben ist, die sie nicht offen für ihre reale Gegenwart machte. „Das Dasein meiner Mutter war meines Erachtens nie ein autonomes. Sie hatte sich auf zwei Gegenwartsebenen ihres Lebens fixiert, weil beide nicht zu bewältigende Traumata für sie darstellten. Die eine war ihre immer gegenwärtige Kindheitsebene, über die sie sich zudem belog, was sicher Teil ihrer Bewältigungsstrategie und damit der Fixierung war. Die andere Ebene ewiger Gegenwart war ihr Witwe-sein, das für sie weit mehr bedeutete, als ihren Mann und den Vater ihrer Kinder verloren zu haben und sich in einer feindlichen Welt allein zu behaupten zu müssen…“ (S.154)
Sie hatte keinen Beruf gelernt, glaubte seinerzeit sich auf den Ehemann als Ernährer verlassen zu können und sah sich in der Rolle einer Frau, die der ständigen Kontrolle der Verwandten, der Nachbarn in der Zechensiedlung und der Siedlungs-Geschäftsleitung unterworfen war, von der sie die mietfreie Wohnung und Kohlen für den Winder bekam.
Die Haltung, sich als sog. Kriegerwitwe nichts leisten zu dürfen, führte bei der Mutter auch dazu, dass sie sich den schulischen Bildungsanstrengungen ihrer Tochter vehement widersetzte. Die Tochter sollte nicht auf Gymnasium gehen und auch nicht studieren. Sie sollte rechtzeitig wissen, dass „ihre Bäume nicht in den Himmel wachsen“ und dass sie “sich nicht erheben“ dürfe. Stattdessen sah die Mutter vor, dass die Tochter mit Realschulbildung in die Firma das Vaters eintreten würde, damit der Mutter die mietfreie Wohnung erhalten blieb. Die Zukunft der Tochter war also komplett verplant bis dahin, dass sie mit der Mutter als „Gesellschafterin“ später verreisen sollte, weil sie ja vorher „auf alles für die Kinder verzichtet“ habe.
Es kam alles anders. Die Autorin ging gegen den Willen ihrer Mutter nach der Realschule aufs Gymnasium, war eine erfolgreiche Schülerin und Studentin, heiratete, schrieb viele bewegende Bücher und machte sich auf allen Ebenen von der Mutter unabhängig. In jedem Menschen ruht ein Rätsel. Beim Lesen dieses „Kaleidoskops“ blieb mir die Muttergestalt bis zum Schluss doch ein Rätsel. Besonders seltsam fand ich die Gefühle der Missgunst der Mutter gegenüber ihrer Tochter. Um ein besonders denkwürdiges Beispiel zu nennen. In der Wohnung der kleinen Familie stand ein Klavier, auf der die Mutter gerne spielte, u.a. „Süße Träumerei“ von Tschaikowski, was die Autorin als Kind besonders liebte. Sie wollte unbedingt Klavierstunden nehmen, was die ältere Schwester, aber sie niemals durfte. Wenn man selbst Klavier spielt und Musik liebt, warum bloß hatte die Mutter keine Freude daran, dass ihre Tochter das auch wollte?
Es bleibt zu wünschen, dass dieses aufregende und bewegende Buch viele Leserinnen und Leser findet.
Die Rezensentin Gesine Schmidt verfasste das Buch Von Lissa nach New York und Shanghai. Das Schicksal der jüdischen Familien Metz und Sachs aus der Provinz Posen, erschienen 2018 im Hentrich & Hentrich Verlag Berlin/Leipzig.