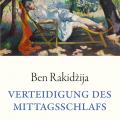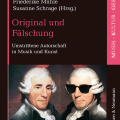Jeder kennt diese Situation: Man betritt einen Fahrstuhl, in dem sich bereits andere Menschen befinden, und plötzlich schließt sich die Tür. Diese meist nur wenige Sekunden dauernde Fahrt, die von einer fast nicht auszuhaltenden Stille gefüllt wird, fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Doch warum ist das so? Welche Wirkung haben kleine Räume auf uns, wie verhalten wir uns darin und warum?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren im fünften Band der Reihe Mikrographien/Mikrokosmen, der den Titel Mikrotopoi. Zur Poetik kleiner Räume trägt. So beleuchtet Niklas Barth in seinem Beitrag beispielsweise den frühneuzeitlichen Hof als sozialen Mikrokosmos der Gesellschaft und dessen Bedeutung für die Ausbildung sozialer Interaktionskompetenzen. Laura M. Reiling untersucht wiederum den Bücherbus als Mikrotopos in Alan Bennetts Erzählung The Uncommon Reader (2006). Alessandra Goggio widmet sich dahingegen dem Autoinnenraum, der durch die Spannung zwischen seiner externen Mobilität und seiner internen Immobilität charakterisiert ist. In Charlotte Cochs Beitrag wird das Raumschiff in der Science-Fiction-Literatur näher unter die Lupe genommen. Des Weiteren greift Julika Griem die akademische Sprechstunde als Mikrotopos im Spannungsfeld von Intimität und Informalität auf. Darüber hinaus untersucht Erik Schilling die Sauna, die sich durch eine besondere Intimität auszeichnet: In ihr besteht ein außergewöhnlich schmaler Grat zwischen höflicher Nicht-Beachtung und Übergriffigkeit. Einen weiteren Mikrotopos der Intimität beschreibt Alexandra Pontzen in ihrem Beitrag, der von Nasszellen wie Toilette und Bad handelt. In eine ganz andere thematische Richtung geht Jan Creutzenberg, der sich der Karaoke-Kultur in Südkorea widmet. Sein Beitrag handelt von dem dort verbreiteten Mikrotopos des Noraebang, eine Art „Lied-Zimmer“. Jaspar Schagerl taucht hingegen in die Filmwelt ein: Er analysiert in Thomas Stubers In den Gängen (2018) die filmische Darstellung kleiner Räume im Handlungsschauplatz eines sächsischen Großmarkts um die Jahrtausendwende. Daneben setzt sich Eric Dewald mit dem televisuellen Phänomen der Bottle Episode und dessen Rolle als Schaubühne reduzierter Räumlichkeit in TV-Serien auseinander. Abschließend beleuchtet Oliver Ruf den Mikrotopos der Echokammer als Metapher für digitale Kommunikationsräume.
Diese Ausgabe bietet eine große Bandbreite an unterschiedlichen Beiträgen, in denen verschiedenste Mikrotopoi aus einer neuen Perspektive betrachtet werden. Es wird aufgezeigt, welche sozialen Regeln den Interaktionen in kleinen Räumen zugrunde liegen und welche Techniken sich in der Moderne ausgebildet haben, um das kommunikative Dilemma in Mikrotopoi zu lösen.