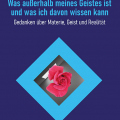Dr. Hans Christoph Niesel ist in seinem zuletzt erschienenen Buch “Kokain – Opium – Cannabis … oder? Schmerz – Mensch – Gesellschaft” der Frage nachgegangen, wie sich das Phänomen des Schmerzes besser verstehen lässt. Dabei skizziert er die Bandbreite menschlichen Schmerzempfindens und geht auf diverse Schmerztherapie-Verfahren im Verlauf der Menschheitsgeschichte ein.
Der Autor fasst weiterhin zusammen:
Die Suche, Komplexität von Schmerz zu verstehen, öffnet den Blick in das weite Feld menschlichen Verhaltens. Humanes Schmerzempfinden unterscheidet sich deutlich von dem anderer Lebewesen. Also verlangt es nach breitem Spektrum der Zuwendung, Pflege, ärztlich-medizinischem Handeln und Begleitung im Leben.
Wer schmerzkrank wird, wer helfen will und kann, ist angesprochen.
Herr Niesel, In Ihrem Buch arbeiten Sie die Vielfalt an Schmerztherapie-Verfahren der Menschheitsgeschichte heraus. Was hat Sie dabei im Verlauf Ihrer Arbeit am nachhaltigsten fasziniert oder bewegt?
Die immens wachsende Erkenntnis neuester Forschung, ursprünglich beschränkt auf ein elektrophysiologisches Modell bis zum gegenwärtigen biochemischen Wissensmuster, erklärt auch die unterschiedlichen Ansätze des Behandelns. Also den Schmerz örtlich oder allgemein bzw. zentral, in der Bewusstseinszone zu beeinflussen. Darin unterscheiden sich die Verfahren zwar grundsätzlich, ergänzen sich jedoch zwingend. Im Verbinden liegt ärztliche Kunst!
Wie sind Sie grundsätzlich zu dem thematischen Schwerpunkt Ihres Buches gelangt?
Ärzte arbeiten im Alltag überwiegend induktiv. Das Individuum, der Patient, steht für Ärzte im Mittelpunkt. Das medizinische Wissen projiziert sich auf dieses Individuum, im Lernen als Arzt wie im späteren Handeln weitet sich der Blick und sucht nach Zusammenhängen.
Die Künste, wie Literatur erfassen Empfindungen, Gefühle des Menschen, sie reflektieren das Menschsein. Soziologie, Philosophie als Wissenschaften und Religionen nähern sich stärker deduktiv, wählen also entgegengesetzte Wege, vom Allgemeinen zum Speziellen. Nach jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung stelle ich mir die Aufgabe, das Verbindende zu suchen, also sich auch intellektuell dem Leiden umfassender zu nähern. Das Wort Anthropologie wirkt wie eine Überschrift für das Umfassen.
In Anekdoten, Erfahrungsereignissen also, spiegeln sich Schicksale. Deren Hintergründe, auch wissenschaftlich, historisch und gesellschaftlich zu verstehen, ist die Herausforderung.
In einer kürzlich erschienen Rezension von Dr. Oliver Emrich wird darüber hinaus zusammengefasst, dass das Buch “im Erzähl- und Reportage-Stil die Anthropologie des Phänomens Schmerz unter kultur- und religionshistorischen Gesichtspunkten [beschreibt]” (Emrich 2024: 52). Insgesamt wird hier eine Empfehlung ausgesprochen, “dieses Buch [sei] ein Muss für jeden schmerzmedizinisch interessierten Leser!” (Emrich 2024: 52)
Die vollständige Rezension in der Zeitschrift der Deutschen Schmerzmedizin (Ausgabe 1/2024) lesen Sie als Mitglied der DGS hier.
Das Buch des Autors ist bei K&N sowohl in Print als auch als E-Book hier erhältlich.