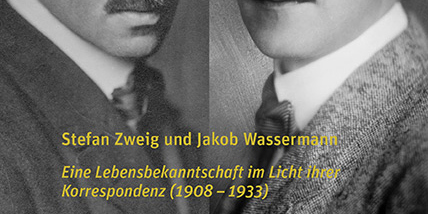Stefan Zweig und Jakob Wassermann – eine wechselvolle Lebensbekanntschaft
„(I)ch habe einen harten Weg zurückgelegt. Sie sind ein Kind des Luxus“, schrieb Jakob Wassermann Stefan Zweig im März 1912.[1] Tatsächlich hätten die Anfänge des literarischen Werdegangs der beiden Autoren nicht unterschiedlicher sein können. Im Unterschied zu Zweig, der aus einer wohlhabenden, großbürgerlichen Familie stammte, war der 1873 im fränkischen Fürth geborene Wassermann in einem von Armut und Lieblosigkeit geprägten kleinbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Erbittert hatte er darum kämpfen müssen, seinen Weg zu finden und sich eine schriftstellerische Existenz aufzubauen. Ungeachtet der unterschiedlichen Herkunft und Werdegänge entwickelte sich eine Bekanntschaft zwischen den beiden, die auf Wertschätzung und Respekt für den jeweils Anderen und sein literarisches Werk beruhte.
Schon früh hatten Wassermanns Veröffentlichungen Zweigs Aufmerksamkeit hervorgerufen und Zweig hatte seinen Freunden dessen erste Romane zur Lektüre empfohlen. Schnitzler, mit dem Wassermann eng befreundet war, registrierte im Juni 1908 in seinem Tagebuch: „Er [d.i. Stefan Zweig, M.E.] sprach in den höchsten Tönen von Wassermann und Hugo [von Hofmannsthal]; und findet wie ich, dass ein solcher Reichtum an Talenten noch nie in Oesterreich geblüht habe.“[2] Bei und mit Schnitzler sollten sich die beiden häufig sehen. Schnitzler gehörte zu den vielen gemeinsamen Bekannten und Freunden, die die beiden besaßen, vor allem aus dem Umfeld des Jung Wien, wie Raoul Auernheimer, Hermann Bahr, Richard Beer-Hofmann, Emil Lucka und Felix Salten. Aber auch Ferruccio Busoni, Richard Dehmel, Gerhart Hauptmann, Hermann Hesse, Thomas Mann, Walther Rathenau und Rainer Maria Rilke zählten dazu.
Als sich Zweig und Wassermann erstmals persönlich begegneten, war Zweig Mitte 20 und Wassermann Anfang 30 Jahre alt. Wenngleich die beiden damals schon erste literarische Erfolge vorzuweisen hatten, standen sie am Anfang ihrer Karriere. Für die jungen Schriftsteller war der Kontakt und Austausch mit anderen Autoren daher ein bereicherndes Element in der beruflichen Entfaltung. Auch wenn Zweig und Wassermann nicht zu den engeren Freunden des jeweils Anderen gehörten, standen die beiden bis kurz vor Wassermanns Tod in vielfältiger Weise miteinander in Verbindung. Sie tauschten sich aus, wenn sie sich zu einem Gespräch zusammenfanden, bei gemeinsamen Freunden oder Veranstaltungen trafen und Postkarten oder Briefe schrieben.
Während Freund- und Bekanntschaften mit anderen Autoren und deren Korrespondenzen schon Gegenstand von Forschungen und Arbeiten über Jakob Wassermann und Stefan Zweig waren, sind die Bekanntschaft und der unveröffentlichte Briefwechsel zwischen den beiden bisher noch weitgehend unbeachtet geblieben. In der National Library of Israel befindet sich die vorhandene Korrespondenz von Wassermann an Zweig. Sie gehört zu den Korrespondenzen, die Zweig 1933 dieser Institution im Rahmen seiner Briefsammlung überlassen hat.[3] Sie umfasst den Zeitraum von 1908 bis 1933. Es sind 13 Briefe und 34 Postkarten und Briefkarten von Jakob Wassermann an Stefan Zweig sowie einen Brief und eine Karte von Julie Wassermann an Zweig. Von Zweig an Wassermann ist kein Brief erhalten geblieben. Jedoch dienen Zweigs Rezension von Wassermanns Roman Caspar Hauser, seine ihm gewidmeten Aufsätze, Briefe und Tagebucheinträge als Quellen für Informationen bezüglich Zweigs Ansicht über Wassermann und dessen Werke sowie die Bekanntschaft zwischen den beiden.
Mit einem Dank Wassermanns für die Zusendung eines Exemplars von Tersites. Ein Trauerspiel in drei Akten beginnt im Februar 1908 die Korrespondenz zwischen den beiden, die zeitweise sehr intensiv in einem persönlichen Kontakt weitergeführt wurde. Allerdings gab es auch lange Phasen ohne Austausch, ohne dass die beiden jedoch das literarische Schaffen des Anderen aus den Augen verloren.
Zweig und Wassermann nahmen ebenso Anteil an den Arbeiten wie an den Unternehmungen des Anderen. Man informierte sich sowohl über aktuelle Buchprojekte als auch über Reisepläne. Manuskripte wurden ausgetauscht und kommentiert. Die Anmerkungen und Kritik des Kollegen waren eine hilfreiche Orientierung und Standortbestimmung. Geradeaus beanstandete Wassermann wiederholt Zweigs Stil als zu manieriert und mahnte ihn gar einmal den Text, „zum Trocknen auf[zu]hängen und [zu] bügeln!“[4] Zweig hingegen bemängelte Wassermanns lückenhaften Realitätssinn. Nicht nur infolge der unterschiedlichen Auffassungen und Herangehensweise an die literarische Arbeit kam es zu Verstimmungen zwischen den beiden. Aber gerade im Ringen um eine Verständigung wird in der Korrespondenz deutlich, wie verbunden sich Wassermann Zweig fühlte, da er bereit war, um die Bekanntschaft zu kämpfen.
1912 widmete Zweig Wassermann ein Porträt, das in der Augustausgabe der Neuen Rundschau erschien. Es war eines seiner ersten, in dem er sich intensiv mit einem deutschsprachigen Autor auseinandersetzte. Er erwies sich als ein aufmerksamer und kritischer Leser, wobei die persönliche Bekanntschaft ihn, laut Donald Prater, „zu einem berufenen Interpreten“ machte.[5] Neben Thomas Mann und seinem Bruder Heinrich erachtete Zweig Wassermann als „die beste Hoffnung auf einen wirklichen deutschen Roman“ und sagte ihm eine verheißungsvolle Zukunft voraus. [6]
Der Erste Weltkrieg erschütterte die Gewissheiten der beiden und entfremdete sie einander. Während sich Zweig dem Pazifismus zuwandte, vertrat Wassermann eine patriotische Haltung. Auch hinsichtlich der Auswirkungen des Krieges auf die jüdische Gemeinschaft waren die beiden unterschiedlicher Ansicht. Während Wassermann ein Abnehmen des Antisemitismus erwartete, befürchtete Zweig dessen Zunahme. Wassermanns Hoffnungen wurden enttäuscht. Wie sehr ihn dies schmerzte, bezeugt die Bekenntnisschrift Mein Weg als Deutscher und Jude. Der Mord an dem gemeinsamen Freund Walther Rathenau traf Zweig und Wassermann gleichermaßen schwer, gerade weil dessen Schicksal ihnen verdeutlichte, dass Juden die uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung immer verwehrt bleiben sollte, ganz gleich, wie sehr sie sich um eine Assimilierung bemühten und egal wie erfolgreich sie mit ihrer Arbeit das deutsche Volk oder die deutsche Kultur repräsentieren würden.
Tatsächlich sollte die gemeinsame jüdische Erfahrung ein unverwüstliches Band in der Bekanntschaft der beiden bilden. Wann immer Zweig Bedarf sah, in diesem Zusammenhang die Stimme zu erheben und aktiv zu werden, war Wassermann einer der Namen, der ihm einfiel, weil er wusste, dass er in dieser Angelegenheit auf ihn zählen konnte. Sowohl Wassermann als auch Zweig verließ nach dem Krieg Wien, um in Altaussee bzw. Salzburg einen zurückgezogenen Wohn- und Arbeitsort, fern von der Hauptstadt, zu finden. Auch einte sie der Erfolg ihres literarischen Schaffens. Die beiden waren einander keine Konkurrenten, weil man ein anderes Genre bevorzugte. Während Wassermann mit seinen Romanen ein immer größeres und internationaleres Publikum gewann, eroberte Zweig die Leserschaft in Österreich, Europa und in aller Welt mit Novellen und Biografien. Auf diese Weise avancierten sie in den 1920er Jahren zu den meistgelesenen und vielfach übersetzten Schriftstellern der damaligen Zeit. Zu den bekanntesten deutschen Autoren ihrer Generation gehörend, mussten beide miterleben, wie der zunehmende Antisemitismus den Weg zu dem Aufstieg und der Machtübernahme der Nationalsozialisten bereitete. Ebenso wie zahlreiche ihrer geschätzten jüdischen und nichtjüdischen Kolleginnen und Kollegen sahen sie sich bald darauf mit dem Verbot ihrer Werke konfrontiert und ihrer Existenz beraubt.
Es ist nicht erstaunlich, dass sie in dem Schicksalsjahr 1933, das eine noch größere Zäsur in ihrem Leben darstellte als der Erste Weltkrieg, den sie beide schon als tiefen Einschnitt empfunden hatten, wieder in einem regelmäßigen Kontakt standen wie zu Beginn ihrer Bekanntschaft. Neben Alfred Döblin, Hermann Hesse und Heinrich Mann gehörte Zweig zu den Freunden und Kollegen, die Wassermann in der Märzausgabe der Neuen Rundschau mit einem kleinen Text zum 60. Geburtstag im März 1933 gratulierten. Zwei Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war diese ostentative und selbstbewusste Würdigung seitens jüdischer Autoren in einer Publikation eines von einem Juden geführten Verlags eine Besonderheit. Zweig, der in Wassermann den „deutschen Balzac“ sah, [7] ließ keinen Zweifel über den Stellenwert Wassermanns in der deutschen und europäischen Literatur: „Die Vormachtstellung Jakob Wassermanns innerhalb der deutschen und sogar der europäischen Epik scheint mir in dem schöpferischen Zusammenwirken dreier Elemente begründet: in einer unablässig regen, zwanghaft schöpferischen Phantasie, in einem fast einmaligen und geradezu dämonischen Pflichtgefühl und Fleiß.“[8] Er hob die Vorbildfunktion hervor, die Wassermann innehat: „Hier ist ein Vorbild beinahe ohnegleichen, wie man durch innere Zucht und grandiose Gewissenhaftigkeit eine vom Schicksal gestellte Aufgabe durch den eigenen Willen noch überhöht und übertrifft und ein fließendes Leben in dauernde Leistung verwandelt: Schaffende aus allen Ländern, hier ist freimütig zu lernen! Hier ist großmütig zu bewundern!“[9]
Von einem Wiener Sanatorium aus sandte Wassermann Zweig am 17. März 1933 ein Dankesschreiben. Darin brachte er nicht nur seine aufrichtige Verbundenheit für die Würdigung zum Ausdruck, sondern ging auch auf die gegenwärtige politische Lage ein:
Lieber Dr. Zweig, es drängt mich zu innerst, Ihnen für Ihre wundervollen Seiten in der Rundschau zu danken. Ich tue es, bescheiden und stolz zugleich, im Gefühl der Legitimität Ihrer Zustimmung zu meinem Wert und mir, wie auch im Bewusstsein der geistigen Katastrophe, die heute über deutsche Menschen hereingebrochen ist, sofern sie Gestalt schaffen wollen und sich dem unveränderlichen Wesen der Kunst zugeschworen haben. Und in dieser Gewissheit Ihres Mitseins und Ihrer Mitkämpferschaft drücke ich Ihnen die Hand.
Ihr
Jakobwassermann
Wenige Monate später standen die beiden zum letzten Mal miteinander in schriftlichem und persönlichem Kontakt. In seinem letzten Brief vom Juli 1933 bat Wassermann Zweig um finanzielle Hilfe. Seine Lage hatte sich nicht nur zunehmend verschärft, da die Einnahmen aus Deutschland wegbrachen. Darüber hinaus spitzte sich die Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau Julie, die inzwischen neben der Drohung einer Versteigerung der Villa in Altaussee die Sperrung des Verlagskontos hatte erwirken lassen. In seiner Not wandte sich Wassermann deshalb an Zweig mit einer Bitte um eine Hypothek. Es ist nicht bekannt, ob Zweig, der Freunde und Kollegen häufig finanziell unterstützte, die gewünschte Hypothek aufnahm oder Wassermann anderweitig half. Aber er war einer von Wenigen, an die sich Wassermann in jenen Tagen wenden konnte, weil er imstande gewesen wäre, eine solche Summe aufzubringen.
Obwohl Zweig nicht entgangen war, wie sehr Wassermann die gesundheitlichen Probleme und privaten Schwierigkeiten zugesetzt hatten, bestürzte ihn Wassermanns Tod am 1. Januar 1934 sehr, wie er die Freunde wissen ließ. Es ist auffällig, wie häufig Zweig in diesem Kontext den Zusammenhalt unter den Freunden beschwor. Ende Februar, keine zwei Monate später, sah Zweig für sich keine Möglichkeit mehr, in Salzburg zu bleiben. Nach Jahren heimatlosen Wanderns und in Niedergeschlagenheit und Verzweiflung über den unwiederbringlichen Verlust seiner Heimat Europa erinnerte er sich im brasilianischen Exil an Wassermanns Novelle „Der unbekannte Gast“ und suchte darin in den letzten Tagen seines Lebens vielleicht noch Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen. Doch im Unterschied zum Protagonisten Mörner, der von seinen Lebens- und Schaffenszweifeln geheilt wurde, vermochte die Lektüre bedauerlicherweise nicht, Zweig zu retten. Für Ernst Feder, Zweigs Vertrauten in Petrópolis, war es „ein ergreifender Gedanke, dass Stefan Zweig in jenen Sommertagen in der schönsten Landschaft wandelnd und diese äussere Schönheit mit allen Sinnen geniessend, innerlich zum Sterben krank und sich niemandem mitteilend, in letzter Stunde nach diesem Buche langte, das, wie er sich erinnerte, sein eigenes Leiden beschrieb und den Heilungsplan aufstellte. Ein letzter Rettungsversuch, der nicht gelingen konnte. Denn schon war er zu schwach, zu tief gebeugt, als dass die Freundeshand, nach der er griff, ihn noch einmal hätte aufrichten können“. [10]
Dr. Marlen Eckl,
Januar 2023
Dieser Beitrag wurde zuerst abgedruckt im Zweigheft 2023. Mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber.
Zur Lebensbekanntschaft zwischen Stefan Zweig und Jakob Wassermann erschien soeben bei K&N
Marlen Eckl/Jeffrey B. Berlin (Hrsg.): Stefan Zweig und Jakob Wassermann. Eine Lebensbekanntschaft im Licht ihrer Korrespondenz (1908 – 1933). Mehr Infos hier.
[1] Brief von Jakob Wassermann an Stefan Zweig, Wien, 1. März 1912. In: Stefan Zweig Collection, ARC. Ms. Var. 305, Series 1: Correspondence, Wassermann, National Library of Israel, Jerusalem. https://www.nli.org.il/en/archives/NNL_ARCHIVE_AL003429054/NLI#$FL81837707 (Stand: 5. Januar 2023).
[2] Schnitzler, Arthur: Tagebuch 1879–1931. Digitale Edition, Mittwoch, 10. Juni 1908, https://schnitzler-tagebuch.acdh.oeaw.ac.at/entry__1908-06-10.html (Stand: 5. Januar 2023).
[3] Vgl. Stefan Zweig Collection, ARC. Ms. Var. 305, Series 1: Correspondence, Wassermann, National Library of Israel, Jerusalem. https://www.nli.org.il/en/archives/NNL_ARCHIVE_AL003429054/NLI#$FL81837633 (Stand: 5. Januar 2023). Sämtliche Briefe von Wassermann an Zweig sind auf dieser Webseite der National Library of Israel einsehbar.
[4] Brief von Jakob Wassermann an Stefan Zweig, Wien, 3. Oktober 1910. In: Stefan Zweig Collection, https://www.nli.org.il/en/archives/NNL_ARCHIVE_AL003429054/NLI#$FL81837649 (Stand: 5. Januar 2023).
[5] Prater, Donald: Stefan Zweig. Das Leben eines Ungeduldigen. München/Wien 1981, S. 479.
[6] Zweig, Stefan: „Jakob Wassermann“. In: Ders.: Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens. Hg. v. Knut Beck. Frankfurt am Main 2007, S. 53-76, hier S. 55.
[7] Zweig, Stefan: „Für Jakob Wassermann“. In: Die neue Rundschau, Jg. 44, 3. Heft, März 1933, S. 358-360, hier S. 359.
[8] Ebd., S. 358.
[9] Ebd., S. 360.
[10] Feder, Ernst: „Letzter Rettungsversuch“. In: Hüben und Drüben. Beilage zum Argentinischen Tagebuch, Jg. XIII Nr. 1622, 1. Juni 1947, o. S.