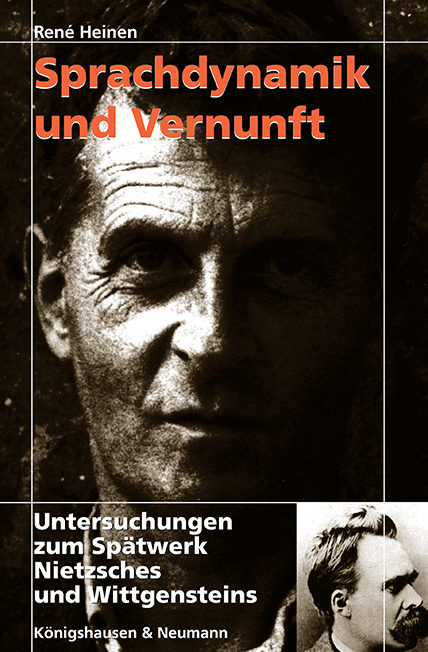Beschreibung
Ausgehend von den wirkungsgeschichtlichen Parallelen, die sich im Zuge des sogenannten Postmodernestreits herauskristallisiert haben, spürt die Arbeit den tiefsitzenden systematischen Zusammenhängen nach, die den Interpretationsgedanken Nietzsches mit der Philosophie der Sprachspiele beim späten Wittgenstein verbinden. Zentral ist dabei der Nachweis, daß die philosophische Theoriebildung in beiden Fällen von einer vorgängigen, immer schon in Geltung befindlichen Praxis ihren Ausgang nimmt, deren Dynamik sich einer endgültigen Positivierung widersetzt. Wird die Mannigfaltigkeit der Sprachspielereignisse sowie die Nichtidentität beständig fortwirkender Machtwillen- und Interpretationsprozesse beachtet, so erweisen sich die Parallelen in der Metaphysik- und Erkenntniskritik als folgerichtig; darüber hinaus wird der Übergang zu einer aphoristischen bis fragmentarisierten Schreibweise als konsequente Umsetzung praxeologischen Denkens verständlich. Die Stilisierung der philosophischen Reflexion hat dann – nach der Verabschiedung metadiskursiver Geltungsansprüche – keine kompensatorische Funktion, sondern versteht sich als Programmpunkt einer zweiten Aufklärung über die Aufklärung, die bereits Baumgarten gegenüber dem Cartesianismus reklamiert hatte. Der Autor René Heinen, geb, 1964. Seit 1985 Studium der Philosophie, Romanistik und Politikwissenschaft in Münster, Madrid und Frankfurt am Main. Promotion zum Dr. phil. 1997. Lehrbeauftragter des Fachbereiches Philosophie und Geschichtswissenschaft der J.W.v. Goethe-Universität Frankfurt am Main.