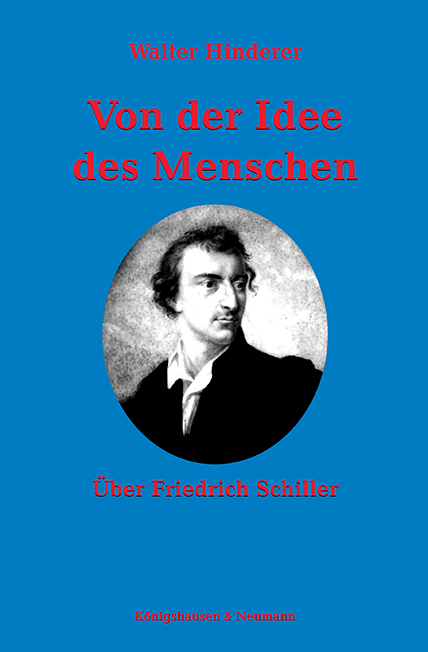Beschreibung
In seinem immer noch lesenswerten Versuch über Schiller charakterisiert Thomas Mann die Leistung des Klassikers folgendermaßen: “Er hat sich ein persönliches Theater-Idiom erfunden, unverwechselbar nach Tonfall, Gebärde und Melodie, sofort als das seine zu erkennen, – das glänzendste, rhetorisch packendste, das im Deutschen und vielleicht in der Weit je erfunden worden, eine Mischung von Reflexion und Affekt, des dramatischen Geistes so voll, daß es schwer ist seither, von der Bühne zu reden, ohne zu ,schillerisieren’.” Nicht von ungefähr galt das “Schillerisieren” im 19. Jahrhundert von Heinrich von Kleist, Georg Büchner, Friedrich Hebbel, Otto Ludwig und Ferdinand Lassalle bis hin zu Rolf Hochhuth als eine prononcierte dramatische Schreibweise, der man sich entweder mit Eifer verschrieb oder von der man sich mit ideologischen Argumenten abwandte. Schillers Doppelbegabung für Begriff und Anschauung, für Verstand und Empfindung, Reflexion und Affekt determinierte ihn zweifelsohne zum Prototyp des sentimentalischen, d.h. modernen Dichters, dessen Werk ebenso auf philosophische, anthropologische, existentielle, ästhetische, poetologische wie auf politische, historische, mentalgeschichtliche und gesellschaftliche Fragestellungen antwortete. Schon als Karlsschüler reflektierte er über die geistige, geschichtliche und politische Situation seiner Zeit, widmete sich dann bald neben seiner poetischen und dramatischen Produktion kulturphilosophischen Spekulationen und nahm schließlich 1793, enttäuscht von der Entwicklung der Französischen Revolution, um das “politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg”. In dem Buch beschäftigen sich im ersten Teil (Sentimentalische Operationen) sechs Kapitel mit den vielseitigen theoretischen Konzepten Schillers: von den Einflüssen Wielands, der rhetorischen Tradition, der Auseinandersetzung mit Bürger, den Ansätzen einer Lyriktheorie bis hin zu den Elementen einer ästhetischen Anthropologie. Der zweite Teil (Pathetische Darstellungen) enthält umfangreiche Dramenanalysen, die den engen Zusammenhang ästhetischer Theorie und dramatischer Praxis veranschaulichen. Das Buch wird eingeleitet von einem zusammenfassenden Überblick von Schillers Leben und Werk, der auch die dichterische und philosophische Entwicklung in den verschiedenen Stationen dokumentiert. Das Buch ist das Ergebnis einer dreißigjährigen Beschäftigung des Verfassers mit dem schwäbischen Klassiker und Intellektuellen. Der Herausgeber Walter Hinderer, geb. 1934 in Ulm, studierte Germanistik, Philosophie, Anglistik und Geschichte in Tübingen und München. Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Princeton University, USA. Zahlreiche Publikationen zur deutschen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, zur Literaturtheorie, Ästhetik, Literaturkritik, Rede und Rhetorik, Mentalgeschichte, zu Politik und Literatur. Außerdem Essays und Rezensionen für “Die Zeit”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” und “Süddeutsche Zeitung”. Bei K&N: Arbeit an der Gegenwart. Zur deutschen Literatur nach 1945; Codierungen von Liebe in der Kunstperiode.