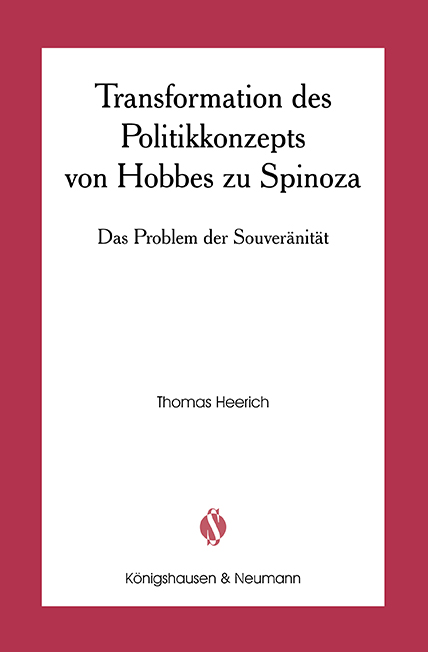Beschreibung
Der staatsrechtliche Begriff der Souveränität ist nach seiner begrifflichen Zuspitzung durch Carl Schmitt (1888-1985) in die Position einer Zwangsvorstellung eingerückt, die die formelle Berechtigung und die tatsächliche Wirkungsfähigkeit der obersten Staatsgewalt zu einem überdeterminierten Syndrom zusammenzieht, das durch seine Anziehungskraft auf andere Felder von Politik ein kathartisches Deutungsvermögen behauptet. Thomas Hobbes (1588-1679) hatte diese Souveränitätskonzeption bereits begrifflich radikal ausgearbeitet. Baruch Spinoza (1632-1677) hat diese Ausarbeitung einer immanenten Kritik unterzogen, indem er die Unterscheidung der potentia der Menge der Bürger und der potestas der Inhaber der Staatsgewalt mit der selbstreferentiellen Struktur von Macht verbindet. Daraus ergibt sich die weitere Unterscheidung zwischen dem – nach seinen Handlungspräferenzen – bewertenden Individuum und dem kollektiven Machtprozeß, so daß der Machtkreislauf zwischen beiden niemals stillstellbar ist, weil niemals alle in der Gesellschaft kursierende Macht institutionell-staatlich kanalisierbar ist. Spinozas Hobbes-Nachfolge und -Kritik bietet damit, wie die Arbeit zeigt, einen Weg, diese mythologische Verdichtung in der Schmittschen Souveränitätskonzeption analytisch aufzulösen. Diese begrifflichen Mittel machen neue Formen von Politik zugänglich, die dann nicht mehr unter das Verdikt, sie seien “indirekte Gewalten”, fallen müssen. Autor Thomas Heerich studierte Philosophie in Düsseldorf und Frankfurt/Main, Soziologie in Hannover. Nach 1985 verschiedene Beschäftigungen an der Universität Hannover.