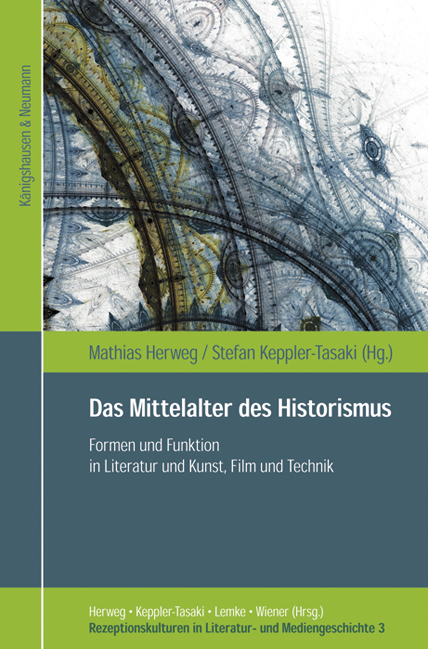Beschreibung
Rezeptionskulturen, als diachron wie synchron ausgerichtete Differenzverarbeitungssysteme, bestimmen den Grenzverkehr zwischen verschiedenen Epochen und Kulturräumen. In ihren verschiedenen historischen Ausprägungen zwischen spätantikem Synkretismus und Postmoderne sowie ihren Niveaudifferenzen zwischen Populärkultur und elitärem Anspruch sind sie vielgestaltig und komplex. Immer aber sind sie verantwortlich für die produktive Aneignung, die mediale Erzeugnisse gegenüber vergangenen und fremden Kulturen wie der Antike, dem Mittelalter, der Renaissance und anderen Kulturräumen (islamische Welt, Asien, Südsee) vornehmen. Sie verlangen ein eigenes Interesse, das die Reihe Rezeptionskulturen bündeln will. Die Reihe versammelt Monographien und Sammelbände aus dem Bereich der Literatur- und der Medienwissenschaft. Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Herausgebergremium: Mathias Herweg (Karlsruher Institut für Technologie), Stefan Keppler-Tasaki (The University of Tokyo), Cordula Lemke (Freie Universität Berlin), Claudia Wiener (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Wissenschaftlicher Beirat: Italo M. Battafarano (Università di Trento), Bettina Bildhauer (University of St. Andrews), Andreas Böhn (Karlsruher Institut für Technologie), Nathanael Busch (Philipps-Universität Marburg), Michael Dallapiazza (Università degli Studi di Urbino), Cora Dietl (Justus-Liebig-Universität Gießen), Norbert Franz (Universität Potsdam), Susanne Friede (Universität Göttingen), Fabienne Liptay (Ludwig-Maximilians-Universität München), Marie-Sophie Masse (Université de Picardie Jules Verne), Petra McGillen (Dartmouth College), Andrea Schindler (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), Robert Schöller (Universität Bern)
M. Herweg / S. Keppler-Tasaki: Einleitung. Das Mittelalter des Historismus. Umrisse einer Rezeptionskultur mit Rückblicken auf den Humanismus – Vorgeschichte(n): Antiquarische Mittelalterinteressen im Humanismus – M.- S. Masse: Frühe Neuzeit und Mittelalter zwischen Alterität und Kontinuität. Memoria und translatio im Ambraser Heldenbuch – C. Wiener: Barbarossas Erbe. Die Kreuzzüge in der Literatur zur Zeit Maximilians I. – M. Rupp: Aurea vetustas – die Bedeutung des frühen Mittelalters für Humanismus und Reformation bei Menrad Molther – K. Strobel: Zurück zum Vers? Der Tübinger Reim-Faust – P. Hv. Andersen Vinilandicus: Die Wiedergeburt der Nibelungen in Dänemark (1580-1603) und auf den Färöern (1817-1851) – Mediävalismus im langen 19. Jahrhundert – R. Häfner: Zivilisation und Reminiszenz. Heinrich Heine und die Dichtung der Troubadours – B. Burrichter: Die mittelalterliche Grundierung der Moderne. Émile Zolas Au Bonheur des Dames (1882) – C. Lemke: Draculas Charme und die subversive Kraft mittelalterlicher Ökonomie – J. Haustein: Vorwärts ins Mittelalter! Rekonstruktion, Ausbau und Funktionalisierung der Wartburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – H. Siebenmorgen: Die Idee des ‚Künstlerklosters‘ im 19. Jahrhundert – B. Schlüter: Hochtechnisierter Romantizismus. Die Modernität des Wilhelminismus und das Mittelalter – K. Möser: Gotische Maschinen und Ritter der Lüfte. Mittelalter als Code der technischen Kultur um 1900 – P. Sprengel: „Die Höhlung der Dome hat etwas Nächtliches.“ Gerhart Hauptmanns Gotik- Bild und sein künstlerisches Selbstverständnis – Mittelalter in den Neohistorismen des 20. Jahrhunderts – M. Däumer: ‚Artus ex machina‘. Theatrale (Re-)Mythisierung in Eduard Stuckens Artusdramen – H. Hartmann: Sinnsuche in der Widerwelt von Maschine und Zeitung. Mittelalter- Bilder im Umfeld des George-Kreises (Hoffmann – Landsberg – von den Steinen) – A. Böhn: Mittelalterrezeption im frühen Film – C. Pinkas: Von der Alchemistenküche zum Science Lab. Topologien der Wissenschaft und Technik im Film der 1920er Jahre – K. Stober: „Ecce Constancia“. Zur Rezeptionsgeschichte des Konstanzer Konzils – V. Groebner: Zum echten Alten bitte hier entlang. Tourismus als Mittelalter-Generator
Die Herausgeber Mathias Herweg ist Professor für Germanistische Madiävistik und Frühneuzeitforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Stefan Keppler-Tasaki ist Associate Professor, University of Tokyo, Faculty of Letters – Graduate School for Humanities and Sociology, German Department.