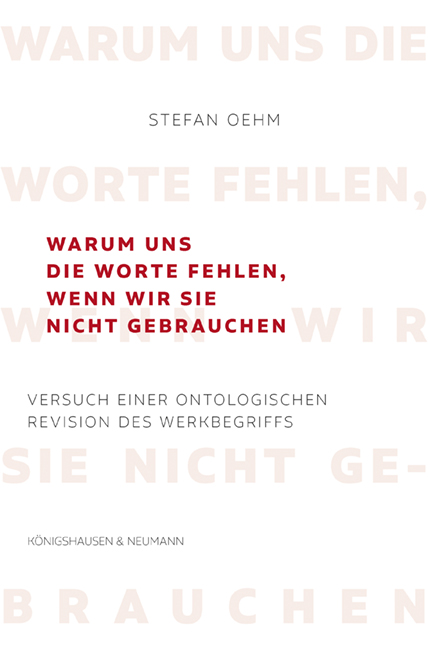Im Kunstdiskurs sind wir gefangen in unserer notorisch dinghaften Weltkonzeption. Kein Wunder, dass wir deshalb fast schon zwangsläufig bei dem Versuch scheitern müssen, die Werke transitorischer Künste ontologisch adäquat zu bestimmen. Triviale Schlussfolgerungen werden nicht gezogen. Animistische Redeweisen gaukeln da präzise Beschreibungen vor, wo sie doch nur den wahren Sachverhalt verschleiern. Weder die Annahme, Nichtexistentes könne Existentes determinieren, noch die, Abstrakta seien Konkreta vorgängig, löst verständnisloses Kopfschütteln aus.
Der Autor Stefan Oehm fasst weiterhin zusammen:
In meinem neuen Buch Warum uns die Worte fehlen, wenn wir sie nicht gebrauchen bemühe ich mich im Rahmen des Versuchs einer ontologischen Revision des Werkbegriffs um eine konsequente Vermeidung solcher und ähnlicher Inkonsistenzen. Dazu gehört auch eine systematische Differenzierung der verschiedenen Aggregatzustände dessen, was uniform ‚Werk‘ genannt wird. Dabei setze ich mich mit relevanten kunstphilosophischen Positionen, insbesondere der typentheoretischen Kunstontologie auseinander, reflektiere das Konzept der Performanz, das auf den Sprechakttheoretiker John L. Austin zurückgeht, ebenso wie das der Konstitution institutioneller Tatsachen von John R. Searle. Gleiches gilt für die unsere Kommunikation bestimmende Idealisierung der Reziprozität der Perspektiven (Alfred Schütz) wie auch für Wilhelm von Humboldts wegweisende gebrauchstheoretische Konzeption der Sprache als ‚eine Thätigkeit (Energeia)‘, die uns geradewegs zu der These führt: Sprachlich verfasste Resultate künstlerischen Schaffens sind transitorische Ereignisse, sie existieren allein im Gebrauch, durch den Gebrauch und während des Gebrauchs durch uns. Sonst nicht.
Im K&N-Blog beantwortet er weitere Fragen zu diesem Projekt.
Herr Oehm, wie ist der Titel Ihres neuen Buches Warum uns die Worte fehlen, wenn wir sie nicht gebrauchen zu verstehen?
Die dinghafte Weltkonzeption ist uns, die in der abendländischen Kultur sozialisiert wurden, in Fleisch und Blut übergegangen. Das geht bis in unseren alltäglichen Sprachgebrauch hinein. Wir begreifen Sachverhalte, haben von ihnen ein Vorstellung. Und wenn wir daran scheitern, dann sind sie für uns unfassbar. Als wäre das noch nicht genug, greifen wir gerne tief in die animistische Trickkiste, gehen mit Abstrakta um wie mit Konkreta und hauchen ihnen zu allem Überfluss auch noch Leben ein. Da wandelt sich die Sprache ebenso wie das Klima, da klettert der Dax und der Markt reguliert sich selbst. Natürlich wissen wir, dass Sprache, Klima, Dax und Markt keine Handlungssubjekte sind, die selbsttätig, bewusst, intentional und zielgerichtet agieren können. Aber trotzdem reden wir tagtäglich so, nehmen das, was wir sagen, gerne beim Wort. So geschehen in jüngeren bildtheoretischen Ansätzen. Mit dieser laxen Sprachweise wird jedoch mehr verschleiert als aufgedeckt. Das Thema meines neuen Buchs ist eingebettet in diese komplexe Thematik, denn wir orientieren uns auch im Kunstdiskurs ontologisch nun mal allzu gerne an dem, was Gottfried Boehm einmal die ‚Handgreiflichkeit‘ genannt hat. Und wenn ich ‚Kunstdiskurs‘ sage, meine ich nicht den verengten Begriff ‚Kunst‘, der allein auf die bildende Kunst referiert, sonst den alle Künste und alle künstlerischen Werke umfassenden, erst seit dem 18. Jahrhundert gegebenen Oberbegriff ‚Kunst‘. Diese Orientierung an der Handgreiflichkeit erklärt unsere Schwierigkeit, solche Werke der Künste ontologisch und begrifflich adäquat zu fassen, die keine physisch präsenten, dauerhaft existierenden und damit, wie ich es nenne, persistierenden Resultate künstlerischen Schaffens hervorbringen. Dies betrifft alle im weitesten Sinne ephemeren Künste, also Musik, Tanz, Theater, Medienkunst wie auch Aktionskunst, Poetry-Slam oder Artistik. Ganze Generationen von Geisteswissenschaftler*innen haben sich an der Frage abgearbeitet, was denn nun eigentlich das Werk-Pendant dieser ephemeren Künste sein soll und wie es, was ich das transitorische Resultat künstlerischen Schaffens nenne, ontologisch angemessen zu fassen ist. Dass dabei eine Begrifflichkeit zum Einsatz kommt, die für persistierende Entitäten gemacht ist, lässt schon erahnen, dass es hier zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis kommen kann. Bei meinem Versuch einer ontologischen Revision des Werkbegriffs gehe ich noch einen Schritt weiter und erweitere die ephemeren Künste um eine Kunst, die zwar als Verlaufskunst gilt, aber gemeinhin nicht zu den ephemeren Künsten gezählt wird: die Literatur. Genauer gesagt: um die Künste, die in irgendeiner Weise mit sprachlich verfassten ‚Werken‘ operieren. Also auch die ‚Werke‘ bildender Künstler*innen wie Barbara Kruger, Jenny Holzer, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner oder auch Markus Vater. Dabei greife ich Wilhelm von Humboldts wegweisende gebrauchstheoretische Konzeption der Sprache als eine Tätigkeit auf und versuche sie konsequent anzuwenden. Humboldt sagt, Sprache sei etwas beständig und in jedem Augenblick Vorübergehendes. Sie sei nur im Akt ihres wirklichen Hervorbringens gegeben und muss stets aufs Neue erzeugt werden. Und selbst die Erhaltung in der Schrift ist für ihn nur eine unvollständige, mumienartige Aufbewahrung. Wenn wir sie nicht im lebendigen Vortrag zu versinnlichen suchen, ist sie nicht: Sprache ist also Sprache eigentlich nur in unserem Gebrauch, durch unseren Gebrauch und während unseres Gebrauchs. Mithin sind also auch die Wörter nur dann in der ihrem Wesen angemessenen Weise gegeben, wenn wir sie gebrauchen. Sonst nicht.
Was fasziniert Sie persönlich an der Kunsttheorie im Allgemeinen? Und wie sind Sie zu diesem Schwerpunkt gelangt?
Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Kunst studieren. Das hat, aus verschiedenen Gründen, nicht geklappt. Was auch gut so war. Mit meinem zeichnerischen Talent konnte ich später zwar in meinem Brotjob, der Werbung, als Creative Director so manchen Grafiker mit meinen Scribbles piesacken. Aber zu mehr hat’s künstlerisch nicht gereicht. Statt Kunst habe ich Germanistik und Philosophie, Schwerpunkt Sprachphilosophie studiert. Das war für mich am Ende die deutlich bessere Wahl, da ich hier meine Lust am analytischen Denken, an der begrifflichen Präzision, mit meiner Lust am Formulieren und Fabulieren, an der rhetorischen Finesse und argumentativen Schärfe verbinden konnte. Diese Affinität zur Kunst, zu eigenem kreativem Schaffen, zum Schreiben und zum analytischen, aber auch assoziativen, ungebundenen Denken war für mich die ideale Voraussetzung für meinen Einstieg in die Werbung. Nach einigen Jahren ergab sich dann durch Zufall und glückliche Fügung – meine Frau ist Kunsthistorikerin – die Möglichkeit, parallel zu meinem Brotjob gemeinsam mit ihr und einem Partner eine Galerie für aktuelle Kunst erst in Essen, dann in Düsseldorf zu eröffnen. Für mich sozusagen das Substitut meiner eigenen künstlerischen Tätigkeit. Diese Jahre in der Galerie waren für mich prägend. In jeder Hinsicht. Was für großartige Ausstellungen wir damals gemacht haben! Betriebswirtschaftlich gesehen eine einzige Katastrophe. Aber künstlerisch? Bei aller Bescheidenheit: Die Qualität, die wir damals gezeigt haben, war bemerkenswert. Ebenso bemerkenswert wie die zum Teil abendfüllenden Auseinandersetzungen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Diese Kontakte sind nie abgerissen. Und Gespräche wurden weitergeführt. Insofern bin ich gar nicht so sehr zu dem Schwerpunkt gelangt, das klingt ein wenig so, als hätte ein Plan dahinter gestanden. Nein, der Schwerpunkt war latent eigentlich immer schon da. Alles Weitere hat sich ergeben. Als ich, aufgrund einiger glücklicher und einiger weniger glücklicher Umstände, in der Werbung kürzer trat, habe ich mich an all das erinnert, was mich immer schon im Kunstdiskurs umtrieben hat. Wie mich da die mangelnde begriffliche Präzision auch bei ausgewiesenen Koryphäen gestört hat! Was ich stets hab sagen wollen, es aber nie so hab sagen können, wie es hätte gesagt werden müssen. Ich wurde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Äußerst unbefriedigend. Aber ich wusste ja, was es bedeutet, das Niveau zu erreichen, das für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung unabdingbar ist. Wissenschaft lässt sich nun mal nicht zwischen Tür und Angel betreiben. Abends nach acht, nach einem langen Arbeitstag, wenn die Kinder hoffentlich im Bett sind – das geht einfach nicht. Aber wie gesagt: Vor einigen Jahren hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich mich ganz der kunsttheoretischen Auseinandersetzung widmen konnte, bei der ich immer wieder grundsätzlich anderer Ansicht war als andere, ihnen aber nie genau das sagen konnte, was ich eigentlich meinte. Aber ich wusste ja von Wittgenstein, dass sich das, was sich überhaupt sagen lässt, auch klar sagen lässt. Es lag also allein an mir. Deshalb war klar, was ich zu tun hatte. Und nun, nach meinem neuen Buch, dämmert mir so langsam: Es gibt über das hinaus, was ich zu tun hatte, noch so viel mehr zu tun. Die Lücken, die ich in der Kunsttheorie entdecke, wollen gefüllt werden. Dass ich bei dieser Gelegenheit erfahren musste, dass meine eigenen Lücken nicht kleiner, sondern eher größer werden, nehme ich liebend gern in Kauf. So faszinierend und erfüllend ist für mich diese intellektuelle Auseinandersetzung.
Schon im Untertitel merken Sie an, dass es sich um einen Versuch handelt, den Werkbegriff ontologisch zu revidieren. Warum ist es wichtig, diesen Versuch trotzdem zu wagen? Welchen Beitrag hoffen Sie, mit Ihrem Text zu leisten?
Nun ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zumindest keine Erkenntnis. Und für die Aussicht auf Erkenntnisgewinn war es dieses Wagnis allemal wert. Was ich mir erhoffe? Zunächst einmal: Ich bin kein Kunsthistoriker. Deshalb maß ich mir auch nicht im Entferntesten an, fachlich den Expert*innen auf Augenhöhe begegnen zu können. Hier bleibt der Schuster brav bei seinen Leisten. Und beruft sich lieber auf seine analytische Schulung. Sprich: Ich will die Begriffsverwendungen des Kunstdiskurses auf Herz und Nieren prüfen, vor allem die seiner zentralen, zumeist völlig unbefangen benutzten Begriffe. Dabei spüre ich gezielt Inkonsistenzen nach. Und ziehe aus längst formulierten Erkenntnissen triviale Schlussfolgerungen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie mich dann zu Ergebnissen führen, die quer zu allgemein akzeptierten Auffassungen stehen. Schon deshalb ist es für mich wichtig, diesen Versuch gewagt zu haben. Sich ständig im Kreise zu drehen, macht schwindlig. Und bringt einen nur scheinbar weiter. Nun zurück zu ihrer Frage: Was hoffe ich, mit meinem Text zu leisten? Ich erhoffe mir natürlich viel, erwarte aber wenig. Wenn es dem Text gelänge, durch seine latente Subversion den einen oder anderen dazu zu animieren, liebgewonnene Lehrmeinungen hier und da in Zweifel zu ziehen, wenn es ihm gelänge, die Perpetuierung tradierter Begrifflichkeiten und Denkmuster ein wenig aufzubrechen, wenn er zu etwas mehr sprachlicher Sensibilität anregen könnte – das wäre schon weit mehr, als ich je zu hoffen gewagt habe.